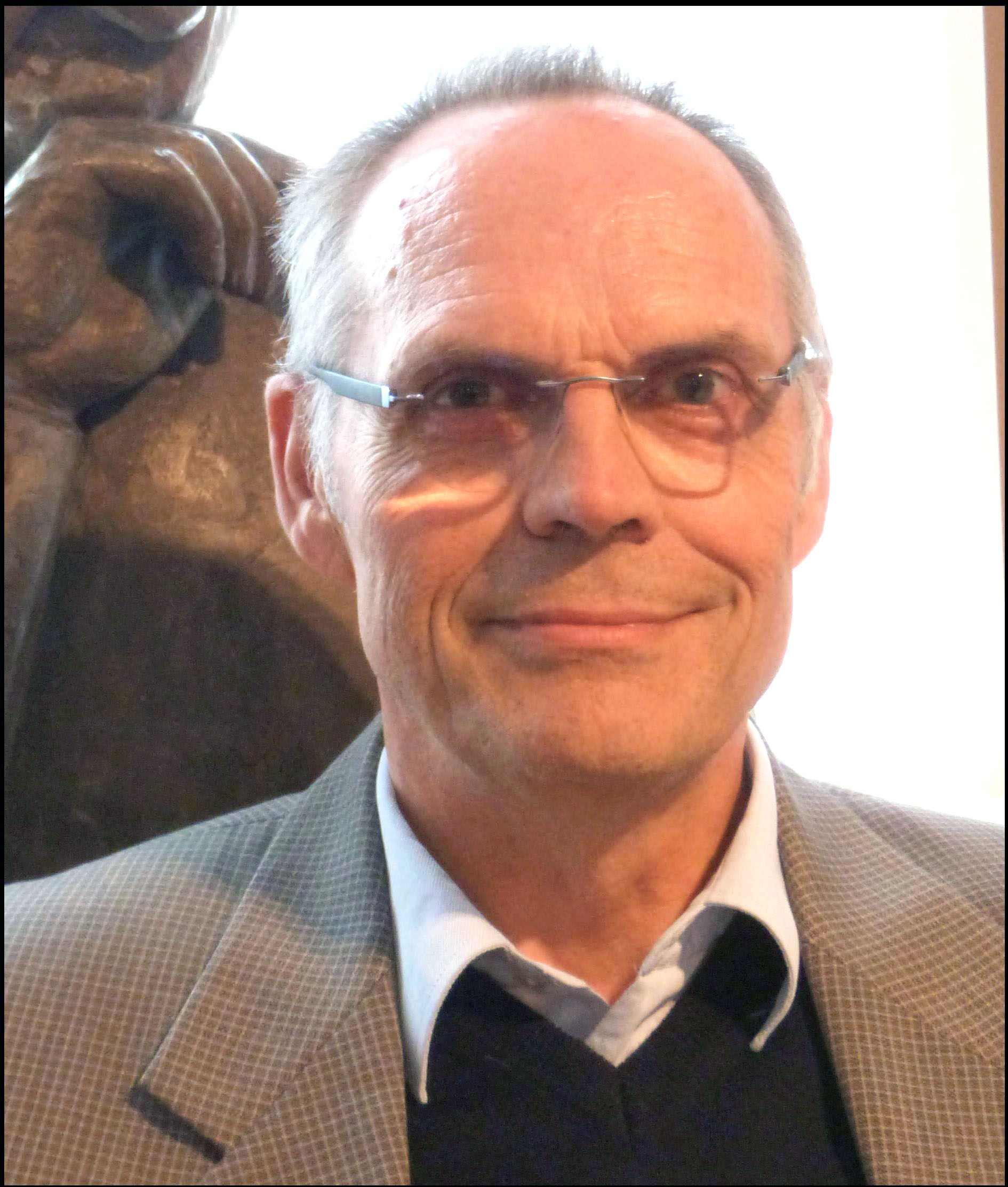(20.02.2025) Seit dem 14. Januar gedenken wir in diesem Jahr des 150. Geburtstages von Albert Schweitzer – eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Theologe, Philosoph, Musikwissenschaftler und Organist hat er vielfältig gewirkt und bedeutende Werke geschaffen. Als Arzt hat er im äquatorialafrikanischen Gabun ein Spital aufgebaut, das bis heute besteht. Für sein geistiges und humanitäres Lebenswerk erhielt er den Friedensnobelpreis (für 1952, 1954 in Oslo ausgehändigt). Sein Denken und Handeln bilden eine glaubwürdige Einheit. Angesichts vielfältiger gesellschaftlich-politischer Konflikte und der Bedrohung der Schöpfung im Kleinen wie im Großen ist Schweitzers Ethik aktueller denn je. Ein außergewöhnlicher Lebensweg - ein herausragendes Lebenswerk Am 14.1.1875 im elsässischen Kaysersberg geboren, wuchs Schweitzer im ländlichen Günsbach (Nähe Colmar) auf, wo sein Vater als Pfarrer wirkte. Nach Schule und Abitur studierte er ab 1893 Theologie und Philosophie an der Universität Straßburg. In den Jahren 1898 und 1900 legte Schweitzer seine beiden theologischen Examen ab, daneben promovierte er in Philosophie und Theologie. Begleitend zum Vikariat an St. Nicolai in Straßburg habilitierte er sich an der dortigen ev.-theologischen Fakultät. Neben seinen wissenschaftlichen Studien und seiner theologisch-praktischen Arbeit widmete er sich intensiv dem Orgelspiel, vor allem dem Werk Johann Sebastian Bachs, ebenso dem Orgelbau. Das Orgelspiel erlernte er bereits als Kind und war schon als Student ein gefragter Konzertorganist. Obwohl ihm eine Doppelkarriere als Universitätsprofessor und als Organist offen stand, blieb er einem früheren Gelübde treu. Aus Dankbarkeit für das ihm zuteil gewordene Glück fasste Schweitzer bereits als einundzwanzigjähriger Student einen Beschluss: Ab dem dreißigsten Lebensjahr seine ganze Kraft für „ein unmittelbar menschliches, wenn auch noch so unscheinbares Dienen“ einzusetzen. Er verstand diesen Dienst als ein Ja zum Ruf Jesu, ihm nachzufolgen. Er war einzig von dem Gedanken erfüllt, als Jünger Jesu dort zu dienen, wo er ihn braucht. Ein Aufruf der Pariser Missionsgesellschaft ließ ihn zunächst auf eine Missionstätigkeit im Kongo hoffen. Weil er aber wegen seiner unerwünschten liberalen Theologie abgelehnt wurde, erbot er sich zusätzlich Medizin zu studieren, um in Afrika als Arzt zu wirken. Im Jahre 1913 gründete Albert Schweitzer zusammen mit seiner Frau Helene auf dem Gelände der Pariser Evangelischen Mission in Andende bei Lambarene ein Urwaldspital. Als erster Behandlungsraum diente ein verlassener Hühnerstall. Die Kranken mussten in einem alten Bootsschuppen untergebracht werden. Doch im Laufe der Jahre gelang es ihm unter Mithilfe der nicht leicht zu beschaffenden afrikanischen Arbeiter, ein kleines Krankendorf aufzubauen. Nach dem Ersten Weltkrieg und erzwungenem Aufenthalt in Europa kehrte Schweitzer 1924 – ohne seine kranke Frau Helene und die kleine Tochter Rhena – nach Afrika zurück und baute das inzwischen weitgehend zerfallene Spital wieder auf. Zusätzlich zu seiner schweren ärztlichen Tätigkeit im Urwald war er unermüdlich weiter für den Ausbau des Krankenhauses im Einsatz. Des nachts saß er am „Krankenbett der Menschheit“.
Ethiker für alle Kreatur
Was war der Anlass? Schweitzer betrachtete den technischen Fortschritt und die Kulturentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts mit tiefer Sorge. Neben dem ungeheuren Zuwachs an Wissen und Können musste er feststellen, dass der moderne Mensch ethisch-geistig immer mehr verkümmert. In allen Bereichen sah Schweitzer die Gefahr zunehmender Unmenschlichkeit aufziehen. Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges war dafür eine ruinöse Bestätigung. Er erkannte, dass die Zukunft der Menschheit davon abhängt, inwieweit es gelingt, ein tragfähiges Fundament der Ethik zu finden, das alle weltanschaulich-religiösen und kulturellen Unterschiede der Völker überbrückt. Dieses Fundament bildet die „Ehrfurcht vor dem Leben“ – eine neue Humanitätsgesinnung, die sich für alles Leben dieser Erde verantwortlich weiß: „Also wage sie den Gedanken zu denken, daß die Hingebung nicht nur auf Menschen, sondern auch auf die Kreatur, ja überhaupt auf alles Leben, das in der Welt ist und in den Bereich des Menschen tritt, zu gehen habe.“ Wodurch aber kommt dieser Gedanke zustande? – Das ethische Denken geht von der „unmittelbarsten und umfassendsten Bewußtseinstatsache“ aus: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“. Wer über diese Tatsache tiefer nachdenkt, erkennt seine Verbundenheit mit allem Leben, ja mit dem Sein im Ganzen, dessen Teil er ist. Die Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und seine Mitwelt nötigt ihn, daraus für einen menschlichen Aufenthalt auf dieser Erde, ein friedliches Wohnen (Ethos), die entsprechende Konsequenz zu ziehen: „Ethik besteht also darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben. Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern, böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen“. Wie weit die miterlebende und helfende Anteilnahme an anderem Leben zu gehen hat, muss jeder für sich entscheiden. Sie kann niemandem von außen auferlegt werden. Sie führt zu einer „ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegen alles, was lebt.“ „Erlebt der Mensch seine Verbundenheit mit allen Wesen, so entspringt daraus die Nötigung zu einem ins Uferlose gehenden Dienen“. Diese Ethik nannte Schweitzer einmal einen „Feuerbrand“, um Licht in das Dunkel der in unserer auf materiellen Fortschritt setzenden Zeit zu werfen. Nur, wenn das Materielle einer Humanisierung in allen Lebensbereichen dienlich ist, kann von einem wahren Fortschritt die Rede sein. Albert Schweitzers universelle Lebensethik, die keine Wertunterschiede zwischen den Lebewesen, welcher Art auch immer, gelten lässt, ist heute hochaktuell. Wie viele Lebewesen werden aus Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit oder gar zum sportlichen Vergnügen geschädigt oder getötet. Wie viel Schädigung anderen Lebens, wie viel Schmerz und Leid könnte vermieden werden, wenn jeder Einzelne im Alltag die Notwendigkeit seines Tuns vor seinem Gewissen prüfen würde! Wir erleben heute weltweit ein gigantisches Ausmaß an Schädigung und Vernichtung von Leben, das die Industrienationen für die Erhaltung und Steigerung ihres Lebensstandards billigend in Kauf nehmen. „Allen tut uns Selbstbesinnung not, die uns aus dem Dahinleben erwachen lässt. In den alten Verhältnissen müssen wir neue Menschen werden, um neue Zustände schaffen zu können.“
Albert Schweitzer in Rheinhessen
Albert Schweitzer verband eine innige Freundschaft mit Karl-Ludwig Schmitt und Familie, dem Inhaber eines renommierten Niersteiner Weingutes. Dort wurde ihm im September 1951 von Prinz Lennart Bernadotte von Schweden die „Medaille für Menschenrechte“ der Uno Cara Pen ausgehändigt. Ein Preis, der vor ihm erstmals an Mahatma Gandhi post hum verliehen wurde. Es folgten in den kommenden Jahren weitere Besuche im Hause Schmitt, das zugleich Begegnungsstätte mit vielen prominenten Persönlichkeiten war. So mit u.a. mit Dr. Elsie Kühn-Leitz und Dr. Ernst Leitz jun., der bedeutenden Pianistin Elly Ney, dem bekannten Bildhauer Louis Mayer oder der Familie des Kirchenpräsidenten Martin Niemöller, mit dem er in späteren Jahren Schulter an Schulter im Kampf gegen den Atomtod gestanden hatte. Dazu verweise ich auf das von Andreas Pitz u. Werner Zager herausgegebene schöne Buch: Spurensuche – Albert Schweitzer in Rheinhessen, Leipzig 2011. Aber auch mit der Walckerorgel der Oppenheimer Katharinenkirche verband Schweitzer eine „tiefe Freundschaft“. Kam Schweitzer nach Nierstein, so ließ er sich es nicht nehmen, die Walckerorgel in Oppenheim aufzusuchen, um Orgelkonzerte zu geben oder einfach nur auf ihr zu Proben. Die 1872 eingeweihte Orgel der Firma Walcker aus Ludwigsburg, die Weltruf genoss, war inzwischen in die Jahre gekommen und erwies sich in Vielem als technisch veraltet, wenngleich aber als erhaltenswerter „Qualitätsbau“. Die seit den 30er Jahren ins Auge gefassten Umbaupläne wurden immer wieder aus finanziellen Gründen zurückgestellt. Als man nach einem Konzert 1954 Schweitzer die neuerlichen Umbaupläne zur Begutachtung vorgelegt hat, verwahrte er sich dagegen: „Diese Orgel umbauen? – Spart doch lieber das Geld“. Ihn verband neben der Hochschätzung der Klangqualität mit dieser Orgel auch ein sehr emotionales Verhältnis: „Aber sehen Sie, wir sind doch Altersgenossen. Ich bin Jahrgang 1875, und die Orgel stammt aus dem Jahre 1871“. In einem Zeitungsbericht zu Schweitzers Orgelkonzert in St. Katharinen im August 1954 heißt es: “Aus seinem meisterhaften Spiel klang die ganze Frömmigkeit zu Gott und die reife Liebe zu den Menschen. Er spielte … Werke von Bach, Mendelssohn und ein modernes Werk von Carl Marie Widor. Auch mit eigenen Kompositionen und Phantasien entlockte der Orgelkünstler dem Instrument den ganzen Zauber des vollen Werks.“ Schweitzer besuchte 1957 die Katharinenkirche zum letzten Mal. Vermutlich auch aus der tiefen Enttäuschung heraus, dass entgegen seinem Rat der Umbau der Walckerorgel doch in Angriff genommen wurde, der ihm so einschneidend schien, dass er deren „Zauber“ verloren glaubte. Zum weiteren „Schicksal“ der Walckerorgel bis heute verweise ich auf das lesenswerte Buch: Faszination Orgel – Beiträge zur neuen Orgel der Katharinenkirchen in Oppenheim, Oppenheim 2006, aus dem ich im dVorstehenden zitiert habe. Noch ein weiterer Rheinhesse darf nicht unerwähnt bleiben, mit dem Schweitzer eine innige Freundschaft verband: Der in Gau Algesheim beheimatete Atomphysiker und SPD-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Karl Bechert. Bechert war der für Schweitzer entscheidende Berater bei dessen Abfassung seiner Anti-Atom-Appelle, die 1957/58 über Radio Oslo weltweit ausgestrahlt wurden. Bechert war der Vater der Anti-Atom-Bewegung und der späteren Ostermärsche sowie ein engagierter Gegner derAtomkraftwerke, als man deren Gefahrenpotential kaum beachtete. Albert Schweitzer erhielt neben dem Friedensnobelpreis (für 1952, 1954 in Oslo ausgehändigt) viele Ehrungen und Auszeichnungen für sein humanitäres Lebenswerk, u.a. den Friedenspreis des deutschen Buchhandels (1951), Insignien des Ordens Pour le mérite (1955) und über zwanzig Ehrendoktorate verschiedenster Fakultäten. Er starb am 4. September 1965 in Lambarene, wo er neben seiner schon 1957 verstorbenen Frau Helene beigesetzt wurde. Der Deutsche Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V. (DHV) mit Sitz in Offenbach trägt wesentlich zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Lambarene-Spitals und allgemein von Albert Schweitzers Lebenswerk bei. Die Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt am Main setzt sich zusammen mit dem DHV für die Verbreitung von Schweitzers umfangreichem ethisch-geistigen Werk ein und unterstützt die Arbeit des Deutschen Albert- Schweitzer-Zentrums in Offenbach am Main mit dessen Archiv und Museum. Anlässlich des 150. Geburtstagsjubiläums finden bundesweit zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt – Orgelkonzerte, Vorträge, Lesungen, Tagungen u.v.m. (Näheres dazu: www.albert-schweitzer-heute.de)
Dr. phil. Gottfried Schüz
Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt am Main